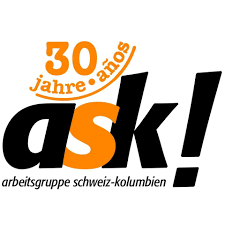Paz Total
Zehn nichtstaatliche bewaffnete Gruppen operieren Schätzungen zufolge aktuell in zwei Dritteln aller Kommunen in Kolumbien. Sie verfügen über 30.000 Personen unter Waffen.(1) Die Regierung Petro führt mit neun Gruppen Gespräche um einen „vollständigen Frieden“ (paz total) zu erreichen.(2) Nach anfänglichen Erfolgen steckt die paz total-Politik heute in der Krise: Wegen wiederholter Verstöße gegen eine Waffenruhe wurden die am weitesten fortgeschrittenen Verhandlungen mit der Guerilla-Gruppe ELN faktisch abgebrochen. Nur mit einer Splittergruppe des ELN in der Region Nariño wird noch verhandelt. Die Gespräche mit Splittergruppen der FARC, paramilitärischen Verbänden und bewaffneten Gruppen in Medellín, Buenaventura und Quibdó stehen am Anfang oder stagnieren. Gleichzeitig fehlen der Regierung Hebel und Strategien, um ein Scheitern der Gespräche zu verhindern: Bewaffnete Gruppen spalten sich immer wieder auf. Gleichzeitig weiten sie durch massives Zwangsrekrutieren junger Menschen ihre Kontrolle über Territorien und (illegale) Ökonomien aus.
In der Folge eskaliert die Gewalt: Feuerpausen werden von allen Gewaltakteuren regelmäßig gebrochen oder scheiterten vollends. Die Zivilbevölkerung wird immer stärker zur Zielscheibe. Wiederholt beobachten NRO, dass staatliche Sicherheitskräfte, vorgeblich wegen vereinbarter Waffenstillstände, nicht eingreifen. In vielen Regionen hat sich die humanitäre Krise zugespitzt.(3) Für die Region Catatumbo verhängte die Regierung Anfang 2025 den Ausnahmezustand – dies lehnen viele NRO wegen der damit verbundenen Militarisierung ab. NRO und betroffene Gemeinschaften fordern, dass bewaffnete Gruppen das humanitäre Völkerrecht einhalten.
Das Format der Paz Total-Friedensgespräche wirft ebenfalls Fragen auf: Beteiligungsverfahren für Konfliktüberlebende und Zivilgesellschaft existieren nur für die Gespräche mit dem ELN und teilweise in Medellin. Es bleibt unklar, wie die Regierung Straflosigkeit und eine Legalisierung von durch Menschenrechtsverletzungen illegal erlangtem Land und Vermögen verhindern will. Zudem existiert bisher keine rechtliche Grundlage für die Verhandlungen mit den Bewaffneten– dies ist eine wesentliche Voraussetzung für deren Demobilisierungsbereitschaft.
Friedensabkommen von 2016
Die Umsetzung des Friedensabkommens von 2016 mit den FARC kommt nur langsam voran. Dem Monitoring des Kroc-Instituts zufolge wurden bis November 2024 nur 34 Prozent der Maßnahmen vollständig, 47 Prozent hingegen minimal oder gar nicht umgesetzt.(4) Besonders Maßnahmen für Gendergerechtigkeit und zum Schutz ethnischer Gruppen werden laut UN nur mit großer Verzögerung umgesetzt.(5) Gründe dafür sind einerseits die Gewalt in vielen Regionen, andererseits der mangelnde politische Wille in der Amtszeit der Regierung Duque und die begrenzten Fortschritte der Regierung Petro. Positiv ist: 12.000 Kämpfer*innen haben ihre Waffen niedergelegt. Gleichzeitig ist die Sicherheitslage demobilisierter FARC-Kämpfer*innen weiter prekär: Von 2016 bis Juni 2025 wurden 470 von ihnen ermordet.
Die Bundesregierung und die EU unterstützen die Umsetzung des Friedensabkommens politisch, fachlich und finanziell. Mittelkürzungen europäischer Staaten drohen nun, dies zu gefährden. Die Regierung Trump hat 2025 mit der Auflösung von USAID bereits Gelder für wichtige Friedensinstitutionen und NRO gestrichen. Um die Umsetzung des Abkommens zu garantieren, bedarf es weiter großer nationaler und internationaler Anstrengungen.
Strukturelle Konfliktursachen: Land, Drogenanbau, Straflosigkeit
Konflikte um Landbesitz, zugang und kontrolle stehen im Zentrum des bewaffneten Konflikts. Über 8,8 Millionen Menschen wurden vertrieben (6), ca. acht Millionen Hektar Land durch Vertreibung enteignet.(7) Land ist extrem ungleich verteilt: Ein Prozent aller Eigentümer*innen besitzt 81 Prozent aller Böden.(8) Das Friedenabkommen sieht vor, dieser Landkonzentration entgegenzuwirken, kleinbäuerliche Familien zu fördern und die ländliche Infrastruktur zu verbessern. Bis Ende 2024 wurden laut Kroc-Institut nur neun Prozent der Maßnahmen vollständig umgesetzt. So erhielten landlose Familien laut UN bis Anfang Februar 2025 gerade sechs Prozent von drei Millionen zugesagten Hektar Land und für nur 46 Prozent von angestrebten sieben Millionen Hektar Land wurden Besitztitel an die kleinbäuerlichen Nutzer*innen vergeben. Die Sicherheitslage behindert viele Reformen im ländlichen Raum. Bedeutende Fortschritte sind die Anerkennung von Kleinbauern und -bäuerinnen als Rechtssubjekte mit besonderem verfassungsrechtlichem Schutz, die Ausweisung von 14 neuen kleinbäuerlichen Schutzzonen (Zonas de Reserva Campesina) bis Mitte 2025 und die Schaffung eines eigenen Justizwesens für Landkonflikte.
Ein Viertel der Bevölkerung Kolumbiens war 2024 von Ernährungsunsicherheit betroffen. Das Friedensabkommen misst der nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion und dem Zugang zu gesunder und ausreichender Nahrung für alle Menschen hohe Priorität zu. Seit Februar 2025 hat das Recht auf Nahrung Verfassungsrang. Dringend notwendig bleiben landesweite und koordinierte Anstrengungen der Behörden, um Ernährungssicherheit tatsächlich zu erreichen.
Eng verknüpft mit der Landfrage ist der Drogenanbau. Gegenmaßnahmen des Friedensabkommens waren laut Kroc-Institut bis Ende 2024 nur zu 23 Prozent umgesetzt. Ein freiwilliges Substitutionsprogramm (PNIS) soll etwa kleinbäuerliche Familien unterstützen, auf legale Anbauprodukte umzusteigen. Bislang haben nur rund die Hälfte der 180.000 einbezogenen Familien überhaupt einen Teil und nur 1,5 Prozent alle Soforthilfen erhalten. Aufgrund fehlender staatlicher Unterstützung beim Verkauf legaler Erzeugnisse und wegen des Drucks krimineller Gruppen wenden sich viele Familien oft (wieder) dem Anbau von insbesondere Koka und Marihuana zu.
Kernelement des Friedensabkommens zur Bekämpfung von Straflosigkeit und der ganzheitlichen Aufarbeitung von Gewalt im bewaffneten Konflikt ist das Integrale System für Wahrheit, Gerechtigkeit, Entschädigung und Garantien der Nichtwiederholung (SIVJRNR). Dessen drei Institutionen genießen international große Anerkennung, während sie in Kolumbien unter starkem Druck stehen.
Der Abschlussbericht der Wahrheitskommission (CEV) Ende Juni 2022 war ein Meilenstein. Die Umsetzung der Empfehlungen des Berichts stoßt jedoch auf große Widerstände in Behörden und Teilen der Gesellschaft, z. B. hinsichtlich menschenrechtskonformer Reformen von Polizei und Militär (siehe MRKK-Briefing 2024).
Die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP) soll die Verbrechen von FARC, staatlichen Sicherheitskräften und einigen anderen Konfliktparteien strafrechtlich aufarbeiten. Täter*innen, die aktiv zur Wahrheitsfindung beitragen, können auf milde Alternativstrafen hoffen. Bis Mitte 2025 hat die JEP elf große Strafverfahren eröffnet und 200 Anklagen erhoben, u.a. wegen Entführungen durch die FARC oder außergerichtlichen Hinrichtungen durch das Militär. Die Eröffnung eines Verfahrens zu genderspezifischer Gewalt im September 2023 ist ein großer Erfolg, allerdings macht der Prozess kaum Fortschritte. NRO und UN kritisieren zudem, dass Konfliktüberlebende von der JEP nicht ausreichend in die Ausgestaltung der Alternativstrafen einbezogen werden. Die Priorisierung von Regionen und Täter*innen kann dazu führen, dass Straflosigkeit bei vielen anderen Menschenrechtsverletzungen fortbesteht.
Die Sucheinheit für Verschwundene (UBPD) soll die offiziell fast 125.000 (9) gewaltsam Verschwundenen finden. Allerdings hat die Einheit bisher nur 3.000 Verschwundene auffinden und 200 Leichen identifizieren können. Angehörige berichten häufig, dass sie nicht ausreichend in die Suche einbezogen werden. Dank des Engagements vieler Betroffener gilt seit Juni 2024 ein Gesetz, das die Rechte suchender Frauen umfassend festschreibt und den Staat verpflichtet, sie besser zu schützen.
Seit 2012 gilt in Kolumbien ein Gesetz für Opferentschädigung und Landrückgabe. Bisher wurden allerdings erst zwölf Prozent aller als Konfliktopfer Anerkannten individuell entschädigt (1,4 Millionen Menschen), nur 281 Gruppen erhielten kollektive Wiedergutmachung (10) und nur zehn Prozent des geraubten Landes wurde zurückgegeben (814.000 Hektar).(11) Das Gesetz gilt bis 2031.
WIR EMPFEHLEN DER BUNDESREGIERUNG UND DEN MITGLIEDERN DES BUNDESTAGS
- die Umsetzung des Friedensabkommens von 2016 weiter politisch und finanziell im bisherigen Umfang zu unterstützen. Prioritär gefördert werden sollten Vorhaben, die die strukturellen Konfliktursachen in den Blick nehmen: die Landreform, die Vereinbarungen zu Gendergerechtigkeit, Maßnahmen zum Schutz ethnischer Gruppen und der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe von Konfliktüberlebenden sowie die Arbeit der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP), der Sucheinheit für Verschwundene (UBPD) und der sie unterstützenden Organisationen;
- von der Regierung Kolumbiens eine wirksamere Umsetzung des Friedensabkommens einzufordern, insbesondere hinsichtlich der Vereinbarungen zu Land, Gender-Gerechtigkeit, dem Schutz ethnischer Gemeinschaften und der Suche nach Verschwundenen;
- die Umsetzung der Empfehlungen des Abschlussberichts der Wahrheitskommission (CEV) zu unterstützen;
- Friedensgespräche mit anderen bewaffneten Gruppen im Rahmen von Paz Total politisch, technisch und finanziell zu unterstützen und aktiv zu begleiten;
- angesichts der weltweit starken Kürzungen in der internationalen Kooperation Sondermittel für zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen bereitzustellen;
- eine transparente und regelmäßige Prüfung der Verwendung öffentlicher Mittel durchzuführen, damit deutsche und EU-Gelder im Sinne der Friedensprozesse eingesetzt und Konfliktüberlebende und die Zivilgesellschaft stärker an Entscheidungen über den Mitteleinsatz beteiligt werden.
1. Fundación Pares und Vivamos Humanos (Juni 2025): La paz ¿cómo vamos?
2. Zu den Gruppen gehören: Estado Mayor Central (EMC), ein Zusammenschluss von ex-FARC-Einheiten, die den Friedensvertrag 2016 nicht unterzeichnet haben; nur der seit April 2024 abgespaltene Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) verhandelt noch mit der Regierung. Segunda Marquetalia, eine Gruppe von ex-FARC-Kämpfer*innen, die den Friedensvertrag von 2016 aufgekündigt haben; aktuell verhandelt nur die Ende 2024 abgespaltene Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) weiter mit der Regierung. Außerdem führt die Regierung Gespräche mit den paramilitärischen Verbänden Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), auch als Clan del Golfo bekannt, und den Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) sowie mit den bewaffneten Gruppen Los Shottas und Los Espartanos in Buenaventura sowie diversen Gewaltgruppen in Medellín und Quibdó.
3.RotesKreuz(März2025):Jahresbericht2024;StaatlicheOmbudsstellefürMenschenrechte(Februar2025): EmergenciasHumanitarias.
4. Kroc-Institute (Juni 2025): 9. Bericht zur Umsetzung des Friedensabkommens von 2016.
5. UN-Verification Mission in Colombia (März 2025): Bericht II. Quartal 2025.
6. Zentralregister für Konfliktopfer (März 2025).
7. Abschlussbericht der Wahrheitskommission, CEV (Juni 2022).
8. Oxfam (Juli 2017): Radiografía de la desigualdad.
9. Sucheinheit für Verschwundene (April 2025): Portal de Datos de la UBPD.
10. Kommission zur Überwachung der Umsetzung des Gesetzes 1448 (August 2024): 11. Bericht.
11. Forjando Futuros (Juni 2025): Análisis de las restituciones en el país.